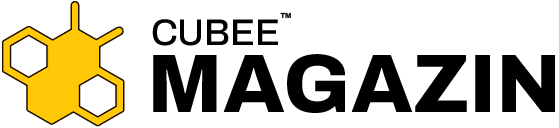Audits sind entscheidend, um Datenlecks bei Drittanbietern zu vermeiden. Sie prüfen Sicherheitsmaßnahmen, decken Schwachstellen auf und sorgen für DSGVO-Compliance. Drittanbieter sind oft ein Risiko, da 19 % aller Datenpannen auf deren Schwachstellen zurückzuführen sind – mit durchschnittlichen Kosten von 4,67 Mio. Euro pro Vorfall. Regelmäßige Audits minimieren diese Risiken und stärken das Vertrauen.
Wichtige Maßnahmen:
- Risikobewertung: Alle Drittanbieter und deren Sicherheitsmaßnahmen prüfen.
- Sicherheitsstandards: Zugriffskontrollen, Verschlüsselung und regelmäßige Updates sicherstellen.
- Audit-Zeitplan: Hochrisiko-Anbieter vierteljährlich prüfen.
- Rechtliche Absicherung: DSGVO-konforme Verträge und Dokumentation.
Effektive Audits schützen nicht nur sensible Daten, sondern vermeiden auch hohe Bußgelder und Reputationsschäden.
Risiken bei der Datenweitergabe an Drittanbieter
Die Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern birgt erhebliche Gefahren, da sensible Informationen in fremde Hände gelangen können. Laut einer IBM-Studie sind 19 % aller Datenpannen auf Schwachstellen bei Drittanbietern zurückzuführen. Die finanziellen Schäden belaufen sich dabei durchschnittlich auf 4,67 Millionen Euro pro Vorfall. Besonders heikel wird es, wenn personenbezogene Daten betroffen sind, da hier zusätzliche DSGVO-Bußgelder drohen. Diese Risiken verdeutlichen, wie entscheidend der Umgang von Drittanbietern mit Daten ist.
Wie Drittanbieter mit Daten umgehen
Externe Dienstleister übernehmen Aufgaben wie die Verarbeitung, Speicherung oder Übertragung von Daten und greifen dabei auf verschiedene digitale Infrastrukturen zurück – von Cloud-Lösungen über Analyse-Tools bis hin zu ausgelagerten IT-Services.
Ein großes Problem entsteht, wenn Hauptdienstleister Subunternehmer einschalten. Dadurch wird die Datenkette oft unübersichtlich und schwer kontrollierbar. Ein Beispiel: Im Jahr 2020 geriet ein internationaler Logistikdienstleister in die Schlagzeilen, weil Kundendaten über mehrere Subunternehmer an ein Drittland mit unzureichenden Datenschutzbestimmungen weitergegeben wurden. Das Resultat: Eine Geldstrafe von 150.000 Euro.
Die DSGVO schreibt vor, dass Unternehmen für die Datenschutzkonformität ihrer Partner haften. Um Risiken zu minimieren, setzen viele Unternehmen auf regelmäßige Audits, die Schwachstellen frühzeitig aufdecken sollen.
Hauptursachen für Datenlecks bei Drittanbietern
Eine Studie des Ponemon Institute aus dem Jahr 2022 zeigt, dass 60 % der Unternehmen Schwierigkeiten haben, die Sicherheitsmaßnahmen ihrer Drittanbieter effektiv zu überwachen.
| Risikofaktor | Typische Ursache | Mögliche Folgen |
|---|---|---|
| Unzureichende Zugriffskontrolle | Fehlende Rollen- und Rechteverwaltung | Unbefugter Zugriff, Datenmissbrauch |
| Mangelnde Verschlüsselung | Speicherung/Übertragung im Klartext | Abfangen, Manipulation, Datenleck |
| Veraltete Sicherheitsstandards | Keine regelmäßigen Updates oder Patches | Ausnutzung bekannter Schwachstellen |
| Unklare Verantwortlichkeiten | Fehlende Dokumentation oder AVV | DSGVO-Verstöße, Bußgelder |
Die Konsequenzen solcher Schwachstellen sind oft gravierend. Ein Beispiel aus dem Jahr 2021: Ein deutscher Cloud-Dienstleister ließ durch eine fehlerhafte Konfiguration Kundendaten wochenlang ungeschützt im Internet. Die betroffenen Unternehmen mussten dies den Aufsichtsbehörden melden und erhielten teils hohe Bußgelder für Verstöße gegen die DSGVO.
Ein weiteres Problem sind gezielte Angriffe auf Mitarbeiter von Drittanbietern. Phishing und Social Engineering haben es auf diese Personen abgesehen, da sie oft Zugang zu sensiblen Daten mehrerer Kunden haben. Ohne ausreichende Schulungen und klare Sicherheitsprotokolle sind solche Angriffe häufig erfolgreich. Zudem stellen veraltete oder ungepatchte Systeme ein erhebliches Risiko dar. Ein Beispiel: Der Cyberangriff auf die Sepah Bank im Jahr 2025 führte zum Diebstahl von 42 Millionen Datensätzen. Solche Vorfälle zeigen, wie wichtig es ist, Sicherheitslücken bei Drittanbietern konsequent zu schließen.
Wie Sie effektive Audits durchführen
Sobald Sie die Risiken der Datenweitergabe identifiziert haben, ist der nächste Schritt, Audits systematisch durchzuführen. Solche Audits helfen dabei, Datenlecks zu vermeiden und die Datensicherheit durch eine strukturierte Herangehensweise zu stärken.
Vorab-Risikobewertung vor dem Audit
Bevor Sie mit dem eigentlichen Audit beginnen, ist eine gründliche Risikobewertung entscheidend. Diese bildet die Grundlage für den gesamten Prozess und sorgt dafür, dass Ressourcen gezielt eingesetzt werden.
Eine vollständige Erfassung aller Drittanbieter mit Zugriff auf sensible Daten ist hierbei unerlässlich. Laut einer Varonis-Studie aus dem Jahr 2024 können 53 % der Unternehmen nicht alle Datenbewegungen bei Drittanbietern lückenlos überwachen. Diese Wissenslücke zeigt, wie wichtig eine systematische Bestandsaufnahme ist.
Überprüfen Sie die Zertifikate und Compliance-Nachweise Ihrer Anbieter. Standards wie ISO 27001, SOC 2 oder TISAX geben erste Hinweise auf deren Sicherheitsniveau. Anbieter, die keine klaren Informationen zu Subprozessoren, Datenfluss oder Speicherdauer liefern, sollten Sie kritisch hinterfragen.
Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Bewertung der Datenkritikalität. Analysieren Sie, welche Datenarten verarbeitet werden und wie sensibel diese sind. Beispielsweise erfordern personenbezogene Daten nach DSGVO strengere Schutzmaßnahmen als allgemeine Geschäftsdaten.
Nutzen Sie einen "Privacy Due Diligence"-Prozess, um potenzielle Risiken zu bewerten. Dabei sollten auch frühere Datenschutzvorfälle des Anbieters sowie dessen technische und organisatorische Maßnahmen berücksichtigt werden.
Auf Basis dieser Erkenntnisse können Sie gezielt Datenzugriffsrechte, Verschlüsselungsstandards und die Einhaltung der DSGVO überprüfen.
Kernelemente eines vollständigen Audits
Ein gründliches Audit sollte mehrere zentrale Aspekte abdecken. Dazu gehört die konsequente Kontrolle, wer auf welche Daten zugreifen kann. Das Prinzip der minimalen Berechtigung sollte dabei strikt eingehalten werden.
Auch die Verschlüsselungspolitik spielt eine zentrale Rolle. Daten sollten sowohl bei der Übertragung als auch bei der Speicherung geschützt sein. Technische Maßnahmen wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Zwei-Faktor-Authentifizierung und ein striktes Rechtemanagement sind unverzichtbar.
Die DSGVO-Compliance verlangt besondere Aufmerksamkeit. Stellen Sie sicher, dass der Anbieter die Grundsätze der Datenminimierung, Zweckbindung und Betroffenenrechte einhält. Dokumentieren Sie alle Audit-Schritte und Ergebnisse sorgfältig, um Ihre Bemühungen im Ernstfall nachweisen zu können.
Technische Maßnahmen wie die Überwachung von Audit-Logs und Alarmmechanismen für ungewöhnliche Aktivitäten sind ebenfalls essenziell. Anbieter sollten in der Lage sein, verdächtige Vorgänge wie ungewöhnliche Datendownloads oder Anmeldeversuche von unbekannten Geräten zu erkennen.
Ein Beispiel aus der Praxis: Ein deutsches Finanzunternehmen konnte durch vierteljährliche, automatisierte Audits drei kritische Schwachstellen entdecken und so ein Datenleck mit 250.000 Kundendaten verhindern.
Zusätzlich können Penetrationstests und simulierte Angriffe genutzt werden, um potenzielle Insider-Bedrohungen aufzudecken.
Regelmäßige Audit-Zeitpläne einrichten
Nach einem ausführlichen Audit sind regelmäßige Überprüfungen notwendig, um Sicherheitsstandards dauerhaft aufrechtzuerhalten. Laut Proliance entstehen 60 % der Datenschutzverletzungen durch unzureichende Zugriffskontrollen und fehlende regelmäßige Audits bei Drittanbietern.
Priorisieren Sie Anbieter mit besonders sensiblen Daten und legen Sie einen risikobasierten Audit-Zeitplan fest. Während jährliche Audits als Mindeststandard gelten, sollten Hochrisiko-Anbieter vierteljährlich überprüft werden. Klare interne Prozesse und Verantwortlichkeiten erleichtern die Durchführung und Dokumentation von Audits.
Zusätzlich zu geplanten Überprüfungen sind anlassbezogene Audits wichtig. Diese sollten durchgeführt werden, wenn sich die Geschäftstätigkeit des Anbieters ändert, neue Subdienstleister hinzukommen oder Sicherheitsvorfälle auftreten.
Die Ergebnisse der Audits sollten strukturiert dokumentiert werden. Erstellen Sie Berichte mit klaren Empfehlungen und Fristen für die Behebung von Schwachstellen. Verfolgen Sie die Umsetzung der Maßnahmen konsequent.
Der Einsatz von Datenschutz-Management-Tools kann die Steuerung und Dokumentation der Prozesse erleichtern. Solche Tools bieten Funktionen wie Erinnerungen für anstehende Audits, Fortschrittsüberwachung und automatische Berichtserstellung.
Die Automatisierung von Audit-Prozessen durch spezialisierte Software und Infrastructure-as-Code ermöglicht es, Sicherheitsrichtlinien frühzeitig zu prüfen und kontinuierlich anzupassen.
Rechtliche Compliance und Verantwortlichkeiten
Neben technischen Prüfungen spielt auch die rechtliche Absicherung eine zentrale Rolle. Der Umgang mit Drittanbietern ist rechtlich oft komplex und kann erhebliche Auswirkungen haben. Unternehmen tragen die Verantwortung für den Datenschutz – selbst dann, wenn externe Dienstleister im Spiel sind. Diese Verantwortung endet nicht mit der Vertragsunterzeichnung, sondern erfordert kontinuierliche Überwachung und Dokumentation.
DSGVO-Anforderungen und deren Auswirkungen
Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) legt klare Regeln für die Zusammenarbeit mit Drittanbietern fest. Unternehmen sind verpflichtet, bei der Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten umfassenden Datenschutz zu gewährleisten – und das gilt auch für beauftragte Dienstleister.
Drittanbieter dürfen personenbezogene Daten nur auf dokumentierte Anweisungen hin verarbeiten und müssen wirksame technische und organisatorische Maßnahmen umsetzen. Auch die Rechte der Betroffenen, wie Auskunft, Berichtigung oder Löschung, müssen garantiert werden. Auftragnehmer müssen zudem bestätigen, dass alle technischen und organisatorischen Maßnahmen (TOM) den DSGVO-Vorgaben entsprechen.
Finanzielle Risiken bei Verstößen sind erheblich: Bußgelder können bis zu 20 Mio. € oder 4 % des Jahresumsatzes betragen – je nachdem, welcher Betrag höher ist. Hinzu kommen mögliche Reputationsverluste und Schadensersatzforderungen.
Ein Vorfall im Jahr 2024 verdeutlichte die Folgen unzureichender Sicherheitsmaßnahmen: Massive Datenlecks führten zu behördlichen Untersuchungen, öffentlicher Kritik und hohen Bußgeldern für Unternehmen, die die DSGVO-Konformität ihrer Dienstleister nicht sicherstellen konnten.
Ein weiterer kritischer Punkt sind Meldepflichten. Unternehmen sind oft gesetzlich verpflichtet, Datenlecks den zuständigen Behörden zu melden. Eine enge Zusammenarbeit mit Datenschutzbehörden hilft, die notwendigen Schritte einzuleiten und rechtliche Anforderungen zu erfüllen. Behörden können zudem bei der forensischen Untersuchung von Vorfällen unterstützen und rechtliche Konsequenzen abmildern.
Diese Regelungen machen deutlich, wie wichtig klare vertragliche Vereinbarungen sind.
Klare Datenvereinbarungen erstellen
Detaillierte Auftragsverarbeitungsverträge (AVV) sind entscheidend, um rechtliche Anforderungen zu erfüllen. Solche Verträge sollten spezifische Sicherheitsanforderungen festlegen und über Standard-Klauseln hinausgehen.
Ein gut ausgearbeiteter Vertrag sollte folgende Punkte enthalten:
- Den genauen Umfang und Zweck der Datenverarbeitung
- Konkrete Sicherheitsmaßnahmen wie Verschlüsselung und Zugriffskontrollen
- Verfahren zur Meldung von Datenschutzverletzungen
- Regeln für die Löschung oder Rückgabe von Daten nach Vertragsende
Zudem sollten Auditrechte, die Nutzung von Subunternehmern und die Einhaltung relevanter gesetzlicher Vorgaben geregelt werden. Häufige Fehler bei der Vertragsgestaltung sind unklare Definitionen der Datenverarbeitung, unzureichende Sicherheitsanforderungen oder fehlende Auditrechte. Diese lassen sich vermeiden, indem standardisierte Vorlagen genutzt, Experten hinzugezogen und Vereinbarungen regelmäßig aktualisiert werden.
Die praktische Umsetzung beginnt mit einer gründlichen Due-Diligence-Prüfung und klaren Datenschutzklauseln in den Verträgen mit Drittanbietern. Das Prinzip der geringsten Privilegien (Least Privilege) sollte für externe Partner gelten, um den Zugriff auf Daten auf das Nötigste zu beschränken. Unterstützend können Vendor Risk Management Tools eingesetzt werden, um DSGVO-konforme Anbieter zu identifizieren.
Klare Datenvereinbarungen schaffen Transparenz über Rollen, Verantwortlichkeiten und Erwartungen bei der Datenverarbeitung. Sie minimieren Missverständnisse und senken das Risiko von Streitigkeiten. Gleichzeitig bieten sie eine rechtliche Basis, um Compliance durchzusetzen und bei Verstößen rechtliche Schritte einzuleiten.
Dokumentation ist dabei unverzichtbar. Alle Details zu Datenlecks sollten gründlich für rechtliche Zwecke dokumentiert werden. Regelmäßige Sicherheitsaudits bei Drittanbietern sind ebenfalls wichtig. Datenschutzaudits, die auf DSGVO-Basis durchgeführt werden, können Schwachstellen in Systemen und Prozessen aufdecken und bei drohenden Bußgeldern von Vorteil sein. Durch Prüfungen von Dokumenten, Gespräche mit Mitarbeitenden und die Analyse von Systemen lassen sich potenzielle Risiken identifizieren und beheben.
In Kombination mit technischen Prüfungen bietet rechtliche Absicherung einen umfassenden Schutz vor Datenlecks.
Best Practices für Datensicherheit bei Drittanbietern
Nachdem eine gründliche Risikobewertung und Audits durchgeführt wurden, ist der nächste Schritt, technische und organisatorische Maßnahmen umzusetzen, um die Zusammenarbeit mit Drittanbietern sicher zu gestalten. Diese Maßnahmen helfen, Datenlecks zu vermeiden und Geschäftsbeziehungen zu stärken.
Verschlüsselung und Zugriffskontrollen
Verschlüsselung ist ein grundlegender Schutzmechanismus gegen unbefugten Zugriff. Alle sensiblen Daten sollten sowohl bei der Übertragung als auch bei der Speicherung verschlüsselt werden. Standards wie AES-256 für gespeicherte Daten und TLS/SSL für Übertragungen bieten dabei bewährten Schutz. In Deutschland empfiehlt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) spezifische Verschlüsselungsverfahren, die eingehalten werden sollten. Beispielsweise müssen Finanzinstitute sicherstellen, dass Kundendaten in der Cloud und während der Übertragung verschlüsselt sind – idealerweise mit Schlüsseln, die intern verwaltet werden.
Rollenbasierte Zugriffskontrollen sorgen dafür, dass Drittanbieter nur die Berechtigungen erhalten, die sie tatsächlich benötigen. Ein Logistikdienstleister sollte beispielsweise nur Zugriff auf Versanddaten haben, nicht jedoch auf komplette Kundendatenbanken. Zugriffsrechte sollten regelmäßig überprüft und nicht mehr benötigte Berechtigungen entzogen werden.
Eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme ist die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), die für alle externen Zugriffe verpflichtend sein sollte. Netzwerksegmentierung kann den Zugriff von Drittanbietern auf bestimmte Systembereiche beschränken, während kritische Infrastrukturen geschützt bleiben. Regelmäßige Überwachung ergänzt diese Maßnahmen und bietet eine weitere Sicherheitsebene.
Überwachung und Berichterstattung
Die kontinuierliche Überwachung ist entscheidend, um Bedrohungen frühzeitig zu erkennen. User and Entity Behavior Analytics (UEBA) Tools helfen dabei, ungewöhnliche Aktivitäten wie große Datei-Downloads oder Anmeldeversuche aus unbekannten Standorten zu identifizieren. Solche Tools können bei verdächtigen Aktivitäten automatisch Warnmeldungen auslösen und Untersuchungen anstoßen.
Automatisierte Warnsysteme und zentrale Dokumentationen ermöglichen schnelle Reaktionen auf mögliche Angriffe. Da viele Angriffe außerhalb der regulären Arbeitszeiten stattfinden, sollte das Monitoring rund um die Uhr erfolgen.
Ein gut strukturierter Berichterstattungsprozess umfasst Echtzeit-Protokollierung, definierte Eskalationswege und regelmäßige Compliance-Berichte. Transparenz wird durch detaillierte Audit-Trails, gemeinsame Überprüfungen und standardisierte Berichtsformate – wie die auf ISO/IEC 27001 basierenden – gewährleistet. Monatliche Sicherheitsberichte, die Zugriffsversuche, Datenübertragungen und behobene Vorfälle auflisten, erleichtern die interne Kontrolle und erfüllen rechtliche Anforderungen.
Data Loss Prevention (DLP) Tools ergänzen UEBA, indem sie unbefugte Datenübertragungen verhindern. Neben technischen Maßnahmen ist es wichtig, alle Mitarbeiter für Sicherheitsfragen zu sensibilisieren, um Schwachstellen umfassend zu schließen.
Mitarbeiterschulungen
Schulungsprogramme sollten Themen wie den sicheren Umgang mit Daten, Passwort-Sicherheit, das Erkennen von Phishing-Versuchen und das richtige Verhalten bei Sicherheitsvorfällen abdecken. Die Inhalte müssen an die jeweiligen Rollen angepasst sein. Entwickler mobiler Apps sollten beispielsweise sichere Programmierpraktiken und die geltenden Datenschutzgesetze kennen.
Praktische Übungen, wie simulierte Phishing-Angriffe, helfen dabei, Schwachstellen aufzuzeigen und das Bewusstsein für Bedrohungen zu schärfen. Regelmäßige Auffrischungskurse stellen sicher, dass die Mitarbeiter auch über neue Sicherheitsrisiken informiert sind.
Die Effektivität der Schulungen kann anhand von Key Performance Indicators (KPIs) gemessen werden – etwa durch die Teilnahmequote an Schulungen, die Anzahl fehlgeschlagener Anmeldeversuche oder die Häufigkeit gemeldeter Vorfälle. Diese Kennzahlen sollten regelmäßig überprüft werden, um Verbesserungen zu erzielen.
Zusätzlich sollten klare Richtlinien und eine Datenklassifizierung eingeführt werden. Mitarbeiter müssen wissen, welche Informationen sensibel sind – etwa personenbezogene Daten oder geistiges Eigentum – und wie sie geschützt werden müssen. Dokumentierte Richtlinien sollten die Nutzung, Übertragungsmethoden und Maßnahmen bei Sicherheitsvorfällen klar definieren.
| Sicherheitsmaßnahme | Zweck | Umsetzung |
|---|---|---|
| AES-256 Verschlüsselung | Schutz ruhender Daten | Verschlüsselung vor Datenweitergabe |
| Multi-Faktor-Authentifizierung | Sichere Zugriffskontrolle | Verpflichtend für alle externen Zugriffe |
| UEBA-Tools | Erkennung anomaler Aktivitäten | Kontinuierliche Überwachung von Datenübertragungen |
| Phishing-Simulationen | Mitarbeitersensibilisierung | Regelmäßig durchgeführte Simulationen |
Fazit: Regelmäßige Audits stärken die Datensicherheit
Regelmäßige Audits sind ein zentraler Baustein für eine sichere Zusammenarbeit mit Drittanbietern. Sie ermöglichen eine kontinuierliche Überwachung, die Schwachstellen aufdeckt, bevor sie ausgenutzt werden können. Vierteljährliche Überprüfungen von Zugriffsprotokollen, DLP-Berichten und privilegierten Aktivitäten helfen Unternehmen dabei, sowohl externe als auch interne Bedrohungen frühzeitig zu erkennen – Bedrohungen, die ohne solche Bewertungen oft unbemerkt bleiben würden.
Strikte Sicherheitsprotokolle und konsequente Kontrolle fördern nicht nur das Bewusstsein für Risiken, sondern sorgen auch dafür, dass Bedrohungen rechtzeitig identifiziert werden. Simulierte Angriffe, wie Phishing- und Datenexfiltrationstests, sind dabei ein effektiver Bestandteil der Audit-Strategie. Sie ermöglichen es, potenzielle Sicherheitslücken zu schließen, bevor sie zu ernsthaften Problemen werden. Das ist besonders wichtig, da viele Datenlecks mit unauffälligen Aktivitäten beginnen, die sich schleichend zu großangelegten Vorfällen entwickeln können.
Darüber hinaus leisten Audits einen wichtigen Beitrag zur Einhaltung der DSGVO. Sie gewährleisten die notwendige Compliance und minimieren das Risiko von Bußgeldern. Auch bei der Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern bleibt die Verantwortung für den Schutz sensibler Daten beim Unternehmen. Regelmäßige Audits helfen, die Risiken von Datenmissbrauch und Datenschutzverletzungen zu reduzieren.
Ohne solche Überprüfungen können sowohl unbeabsichtigte als auch vorsätzliche Insider-Bedrohungen unentdeckt bleiben, was langfristig bestehende Schwachstellen und Sicherheitsprobleme begünstigt.
Die Investition in regelmäßige Audits zahlt sich aus: Sie stärken das Vertrauen der Kunden, minimieren teure Datenschutzrisiken und sichern langfristiges Wachstum in einer datengetriebenen Wirtschaft. Kurz gesagt, Audits sind der Schlüssel zu einer zukunftssicheren und verantwortungsvollen Datenstrategie.
FAQs
Wie können Unternehmen sicherstellen, dass Drittanbieter hohe Sicherheitsstandards einhalten?
Unternehmen können hohe Sicherheitsstandards bei Drittanbietern sicherstellen, indem sie regelmäßige Audits durchführen. Solche Prüfungen helfen dabei, Schwachstellen frühzeitig aufzudecken und gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der Datensicherheit umzusetzen.
Indem die Prozesse und Systeme der Drittanbieter gründlich geprüft werden, lassen sich potenzielle Risiken reduzieren und Datenlecks vermeiden. Ebenso wichtig ist eine enge Zusammenarbeit mit klar definierten Sicherheitsanforderungen, um die Schutzmaßnahmen dauerhaft zu verbessern.
Wie können Unternehmen sicherstellen, dass ihre Zusammenarbeit mit Drittanbietern DSGVO-konform ist?
Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) fordert von Unternehmen, bei der Zusammenarbeit mit Drittanbietern besonders sorgfältig vorzugehen. Dabei steht im Mittelpunkt, dass Drittanbieter wirksame Sicherheitsvorkehrungen implementiert haben, um personenbezogene Daten ausreichend zu schützen.
Unternehmen sollten klare und verbindliche Verträge mit ihren Dienstleistern abschließen, die sicherstellen, dass diese die DSGVO-Vorgaben einhalten. Dazu gehört auch, zu überprüfen, ob der Anbieter alle relevanten Datenschutzanforderungen erfüllt und regelmäßige Audits durchführt, um mögliche Schwachstellen rechtzeitig aufzudecken.
Welche Maßnahmen können Unternehmen ergreifen, um Datenlecks bei Drittanbietern zu vermeiden?
Datenlecks bei Drittanbietern lassen sich durch eine Kombination aus technischen und organisatorischen Maßnahmen wirksam vermeiden. Ein entscheidender Faktor dabei sind regelmäßige Audits, die potenzielle Schwachstellen in den Sicherheitsvorkehrungen frühzeitig aufdecken und beheben können. Unternehmen sollten sicherstellen, dass Drittanbieter strenge Sicherheitsrichtlinien einhalten und diese kontinuierlich überprüft werden.
Zu den weiteren Maßnahmen, die Unternehmen ergreifen sollten, gehören:
- Verschlüsselung sensibler Daten – sowohl bei der Übertragung als auch bei der Speicherung, um unbefugten Zugriff zu verhindern.
- Effizientes Zugriffsmanagement, das sicherstellt, dass nur autorisierte Personen Zugriff auf sensible Informationen haben.
- Einhaltung von Sicherheitsstandards wie ISO 27001 oder anderen Zertifizierungen, die robuste Sicherheitspraktiken belegen.
Durch die Umsetzung dieser Maßnahmen erhöhen Unternehmen nicht nur den Schutz ihrer Daten, sondern stärken auch das Vertrauen in die Zusammenarbeit mit ihren Drittanbietern.
Verwandte Blogbeiträge
- Checkliste: DSGVO-konforme digitale Schadensmeldungen
- Wie minimiert man Risiken bei Drittanbieter-Daten?
- Risikobewertung vs. Schwachstellenmanagement: Unterschiede erklärt
- Wie funktioniert DSGVO-konformes Datenmanagement?